Nach über acht Jahren im Schulsystem hat man ein Gespür. Für mündliche Noten, für „sonstige Mitarbeit“. Man merkt sich viel, man hat sein Bauchgefühl, man schreibt Notizen. Juristisch heißt das: „pädagogische Beurteilung“ (Hoegg, 2016). Und mal ehrlich: Ob es am Ende eine glatte 3 oder schwache 3 ist – geschenkt. Nach ein paar Jahren kriegt man das ganz gut hin.
Dachte ich.
Bis Building Thinking Classrooms (kurz: BTC, deutsch: Denkende Klassenzimmer) kam. Und mich komplett auf die Schnauze fallen ließ. Weil bei BTC passiert so unfassbar viel. Jede:r von 28 Schüler:innen macht irgendwas. Und wenn jemand nichts macht, ist auch das eine Tätigkeit.
Im „klassischen“ Unterricht muss die große Mehrheit der Klasse zuhören, wie wenige reden.
In Dreiergruppen dagegen ist der Wechsel zwischen zuhören, reden, schreiben permanent. Die Interaktionen sind so dicht, dass man als Lehrer kaum hinterherkommt. Effektiver? Absolut. Aber auch: Reizüberflutung. Ich stand da, wollte Noten machen – und dachte: Fuck. Ein paar Szenen hatte ich im Kopf, ein paar Notizen auf dem Block. Aber das reicht nicht. Man muss wirklich mehr Gedanken machen, Mini-Codes entwickeln – sonst geht das alles im Dauerfeuer der Interaktionen unter.
BTC macht Lehrkräfte gleichzeitig glücklich arbeitslos – und gnadenlos überfordert.
Mein größter Irrtum: Noten sind erstmal egal
Hinzu kam meine eigene Arroganz. Als ich mit BTC angefangen habe, dachte ich: Scheiß auf Noten, Hauptsache die Kids arbeiten endlich mal. Dass man das Konzept in Gang kriegt, dass die Kids nicht doch halbtot auf dem Stuhl sitzen, sondern wirklich rechnen, stehen, reden, denken. Noten? Luxusproblem. Dachte ich. Blöd nur: Elternsprechtag steht bald an. Die wenigen Eltern, die kommen, wollen es begründet ausführlich. Sie fordern ein.
Internet-Kritik: „Die Stillen gehen unter“
Googelt man BTC, liest man überall die gleiche Kritik: „Die Stillen versinken. Die Autisten kommen nicht klar. Introvertierte werden überrollt.“
Ja, die Sorge hatte ich auch. Hauptschule, einige autistische Kids, dazu die ganz normalen Schweiger, die lieber unsichtbar bleiben.
Und ja: Am Anfang läuft’s zäh. Man zwingt niemanden von null auf hundert ins Rampenlicht.
Aber was passiert, wenn man dranbleibt? Still heißt nicht unfähig – Still heißt oft: braucht Zeit. Bei meinen Klassen oft mehrere Wochen. Mit der Zeit fingen in meinen Klassen die ruhigen sowie die neurodivergenten Kids an mehr zu reden. Sie wurden aktiver in den Gruppen. Manche fingen nach zwei Monaten sogar an, freiwillig vor der ganzen Klasse vorzutragen. Laut Rückfragen zu stellen.
BTC und besondere Kids
Ein Vater erzählte mir einmal sinngemäß: „Mein Sohn ging früher sehr ungern einkaufen – zu viele Reize, zu viele Menschen, zu viele Geräusche. Aber wir haben das geübt. Er muss es lernen. Heute klappt das meistens gut.“
Genau das passiert im Denkenden Klassenzimmer: Wir gestalten Lernräume, in denen Schüler:innen – auch mit besonderen Wahrnehmungen – Schritt für Schritt lernen, mit der Welt umzugehen.
Ich erinnere mich an einen Schüler im Autismus-Spektrum, der zu Beginn des Schuljahres kaum sprach. Die Vielzahl an Eindrücken schien ihn oft zu überfordern. Lange war er bei BTC still, beobachtend, zurückgezogen. Irgendwann sagte er leise – aber bestimmt: „Ich mach das jetzt. Ich trag vor. Ich mag das zwar nicht, aber ich weiß, dass ich’s lernen muss. Und meine Lösung ist richtig.“
Genau darum geht es in BTC: Nicht ins Rampenlicht stellen, sondern Mut ermöglichen. Selbstsicherheit entsteht nicht durch Druck, sondern durch wiederholte Gelegenheiten, sich auszuprobieren – in einem Rahmen, der schützt und herausfordert zugleich. BTC soll die Schüler:innen nicht vorführen. Es soll Fehler als Lerngelegenheit und Erfolge gleichermaßen feiern. Eine richtige Lösung ist dabei genauso viel wert wie ein guter Fehler – einer, der zum Nachdenken anregt und echtes Lernen ermöglicht.
Tafel hoch, Tafel runter
Andere Szene: Eine Schultafel, die man hoch- und runterschieben kann. Großer Schüler → Tafel hoch. Kleiner Schüler aus der Nachbargruppe → Tafel runter. Großer Schüler flippt aus: „Du kleiner Wixer! Lass das!“ Tabula Rasa. Ich wurde deutlich. Weil BTC nicht nur Mathe ist. Es ist auch: Zusammenarbeit. Respekt. Kollaboration. Und das ist nicht nur eine pädagogische Moral – es ist auch Note.
Mein Raster
Damit das alles bei der Note am Ende nicht nach Bauchgefühl riecht, habe ich ein Raster im Sinne Liljedahls gebaut. Vier Kategorien:
Beitrag zum Denken
1: Ich bringe keine oder sehr wenige Ideen ein.
2: Ich sage manchmal etwas, wenn ich gefragt werde.
3: Ich bringe oft eigene Ideen ein und helfe, weiterzukommen.
4: Ich habe fast immer Ideen, erkläre sie klar und denke mit.
Zusammenarbeit
1: Ich arbeite kaum mit, höre nicht zu.
2: Ich arbeite manchmal mit, aber oft nur auf Nachfrage.
3: Ich arbeite meistens gut mit, höre zu und frage nach.
4: Ich arbeite immer gut mit, helfe anderen und fördere die Gruppe.
Durchhaltevermögen
1: Ich gebe schnell auf.
2: Ich versuche es manchmal weiter, brauche aber oft Hilfe.
3: Ich bleibe meistens dran und probiere Verschiedenes aus.
4: Ich bleibe immer dran, auch wenn es schwer ist, und suche Lösungen.
Reflexion
1: Ich kann kaum erklären, wie wir vorgegangen sind.
2: Ich kann manchmal etwas über unsere Lösung sagen.
3: Ich kann meistens erklären, was wir gemacht haben und warum.
4: Ich kann immer klar erklären, wie wir vorgegangen sind, und sehe auch andere Wege.Zweimal pro Halbjahr bekommen die Kids Punkte (1–4). Eingetragen wird das in unsere Schulapp EduPage. Und während des Quartals kann sich die Bewertung verbessern oder auch verschlechtern – je nach Entwicklung. Acht Rückmeldungen insgesamt. Am Ende mache ich aus diesen Punkten eine „pädagogischer Beurteilung“ und bilde eine Note. Transparent, kein Lehrer-Würfelspiel.
Das Spannende: Auch die Mathe-Verzweifelten können plötzlich glänzen, weil Durchhalten, Nachfragen, Zusammenarbeit zählt. Und die Top-Schüler:innen? Bekommen nicht nur Punkte fürs richtige Ergebnis, sondern fürs Erklären und Mitziehen.
Fazit
BTC im deutschen Schulsystem ist ein Spagat: zwischen Ideal und Zwang, zwischen Denken und Ziffer. Aber es funktioniert – wenn man es ernst meint und nicht nach zwei Wochen „geht nicht“ ruft.
Am Ende bleibt: Noten sind Dienstpflicht. Aber mit dem richtigen Raster sind sie mehr als ein Momentfoto – sie zeigen Entwicklung. Und für die Kids heißt das: Fehler machen, nachdenken, lernen, sich entwickeln – und Selbstsicherheit gewinnen.
Elternbrief zum Kopieren
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte Ihnen und euch erklären, wie der Mathematikunterricht in meiner Klasse funktioniert. Danach beschreibe ich, wie die Leistungen bewertet werden.
==============================
Mathematikunterricht: So arbeiten wir
In unserem Unterricht geht es vor allem um eins: Denken!
Wir arbeiten nach dem Konzept "Denkendes Klassenzimmer" des kanadischen Professors Peter Liljedahl.
In 15 Jahren Forschung hat Professor Liljedahl gezeigt:
Wenn Schülerinnen und Schüler wirklich denken, verbessern sich die Leistungen in Klassenarbeiten – besonders bei Textaufgaben – oft um 1 bis 1,5 Noten.
Das heißt im Alltag:
* Wir arbeiten immer in Dreiergruppen.
* Die Gruppen werden jeden Tag neu ausgelost – per Zufall.
* Wir arbeiten immer stehend an Whiteboards oder Tafeln, nicht nur im Heft.
* Die Aufgaben sind sehr schwer und so gemacht, dass man selber nachdenken muss.
* Wir erklären unsere Ideen, arbeiten zusammen und helfen uns gegenseitig.
Ziel: Jede Schülerin und jeder Schüler soll selbst denken, lernen und mit anderen Lösungen finden.
==============================
Bewertung: So bewerte ich die mündliche Leistung (Sonstige Mitarbeit)
Ich schaue nicht nur auf richtige Ergebnisse. Wichtig ist, wie ihr denkt, mitarbeitet und durchhaltet.
Es gibt vier Bereiche, die ich bewerte.
Jeder Bereich bekommt Punkte von 1 (schwach) bis 4 (sehr stark):
---
1. Beitrag zum Denken
1 – Ich bringe keine oder sehr wenige Ideen ein.
2 – Ich sage manchmal etwas, wenn ich gefragt werde.
3 – Ich bringe oft eigene Ideen ein und helfe, weiterzukommen.
4 – Ich habe fast immer Ideen, erkläre sie klar und denke mit.
---
2. Zusammenarbeit
1 – Ich arbeite kaum mit, höre nicht zu.
2 – Ich arbeite manchmal mit, aber oft nur auf Nachfrage.
3 – Ich arbeite meistens gut mit, höre zu und frage nach.
4 – Ich arbeite immer gut mit, helfe anderen und fördere die Gruppe.
---
3. Durchhaltevermögen
1 – Ich gebe schnell auf.
2 – Ich versuche es manchmal weiter, brauche aber oft Hilfe.
3 – Ich bleibe meistens dran und probiere Verschiedenes aus.
4 – Ich bleibe immer dran, auch wenn es schwer ist, und suche Lösungen.
---
4. Reflexion
1 – Ich kann kaum erklären, wie wir vorgegangen sind.
2 – Ich kann manchmal etwas über unsere Lösung sagen.
3 – Ich kann meistens erklären, was wir gemacht haben und warum.
4 – Ich kann immer klar erklären, wie wir vorgegangen sind und sehe auch andere Wege.
==============================
Wichtig zu wissen:
· Diese Bewertung mache ich zweimal im Halbjahr.
· Am Ende entsteht daraus eine pädagogische Note.
· Die Bewertung kann sich im Laufe der Zeit verändern, wenn jemand Fortschritte oder Rückschritte macht.
· Zusätzlich schreiben wir im Schuljahr fünf Klassenarbeiten.
· Die Klassenarbeiten zählen genau so viel wie diese Bewertung (oben). Beide Teile sind gleich wichtig für die Gesamtnote.
Freundliche Grüße
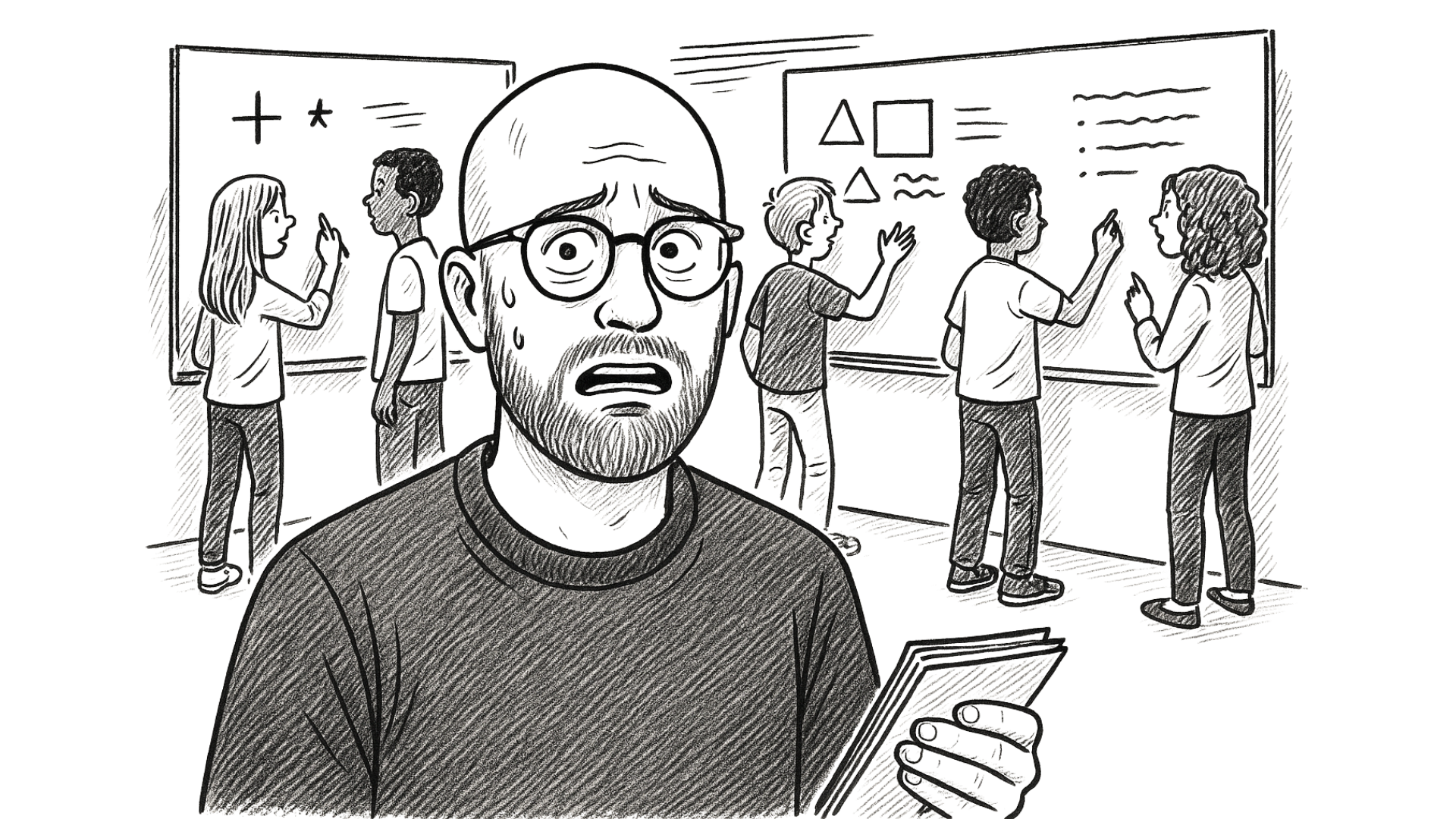
Sag mir die Meinung. Bleibt privat. Wird nicht veröffentlicht.