Zeit ist Macht. Im Unterricht sowieso. Und trotzdem behandeln wir sie wie einen dämlichen Nebencharakter. „Macht halt mal zehn Minuten Aufgabe drei.“ Spoiler: Da passiert exakt nichts. Zehn Minuten sind in Kinderköpfen entweder Ewigkeit oder ein Wimpernschlag. Meistens beides gleichzeitig.
Ich hab irgendwann gemerkt: Mein Unterricht kippt, sobald ich mit Zeit schludere. Dann drehen die Kids frei. Chaos bricht aus. Einmal hat ein 16-Jähriger eine Tintenpatrone gegessen. Im Unterricht. Kein Witz. Und niemand wusste danach, was Thema war.
Klar, vielleicht war die Aufgabenstellung schlecht. Vielleicht war meine Planung kacke. Aber am Ende ist es einfacher, zu sagen: „Die haben halt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr.“
Man versteckt sich zu oft dahinter.
Eine Stunde steht und fällt mit Struktur. Und die beginnt bei der Zeit.
Ich habe das lange total unterschätzt.
Die Sache mit dem Timer
Letztes Jahr bin ich über Doug Lemovs Buch Teach Like a Champion gestolpert. Kapitel 25 oder so. Titel: „Work the Clock“. Seitdem: hat sich mein Unterricht verändert.
Zeit ist nicht Beiwerk. Zeit ist Führung. Wer die Uhr in der Hand hat, führt die Klasse. Punkt. Und ja – Kids lieben das. Selbst wenn sie meckern.
Ich hab mir also diesen TimeTimer besorgt. Erneut. Large. Mit roter Scheibe, die langsam verschwindet.
Im Ref Standardausrüstung. Haben alle. Und nach dem Ref? Wird man bequem. Timer? Im Lehrerzimmer vergessen. Irgendwann hing er irgendwo und verrottete. Ich wusste nicht mehr, wo er war.
Heute läuft das Ding in jeder Stunde. Sichtbar. Groß. Verbindlich. Und siehe da: weniger Störungen, mehr Fokus, bessere Stundenergebnisse.
Lemovs Konzept
Lemov schreibt: „Measure time – your greatest resource as a teacher – intentionally, strategically, and often visibly.“ Die Uhr ist kein Gadget. Sie ist der Taktstock.
Zeit ist begrenzt.
Zeit wird nicht verplempert.
Zeit ist wertvoll.
Nicht: „Wir machen das ungefähr zehn Minuten.“ Sondern: 4 Minuten 30. Weil genau diese 30 Sekunden sagen: Ich meine es ernst.
Und ja, das wirkt.
Zeitfenster sorgen für Struktur im Hirn. Lemov nennt das Chunking. Nicht 30 Minuten Textarbeit und dann Chaos. Sondern:
– 60 Sekunden Sachen rausholen
– 3 Minuten für Aufgabe 1
– 5 Minuten für Aufgabe 2
– 4 Minuten Kontrolle
– 90 Sekunden Einpacken
Zack. Klarer Takt. Und durch diesen Takt bleibt der Kopf bei der Sache.
Der Countdown als Taktstock
Wenn der Timer runterläuft, passiert was. Nicht, weil die Kids plötzlich alle Streber werden. Sondern weil sie beschäftigt sind. Menschen wollen meist Erwartungen gerecht werden, selbst wenn sie diese nicht teilen. Die Schüler:innen merken: Jetzt zählt jede Sekunde.
Lemov nutzt den Countdown aktiv. Er lobt währenddessen. Lenkt den Blick. Holt die Klasse rein. Nicht schweigend runterlaufen lassen – sondern Führung in Echtzeit. Gleichzeitig gilt: Man braucht Flexibilität. Wenn man merkt, die Klasse hängt, ist durch, braucht zwei Minuten mehr – dann gibt man sie. Klar. Aber man geht mit einem Zeitplan rein. Einem echten. Kein Wunschdenken.
Das klingt furchtbar banal. Aber das wirkt.
Was man irgendwann merkt: Der Unterricht flutscht mehr. Er wird anders. Ohne Zauber. Ohne Lichtshow. Nur wegen einem dummen Timer und ein paar Gedanken vorab zur Zeiteinteilung.
Wer ohne Zeitplan unterrichtet, fliegt blind. Und wer blind fliegt, soll sich nicht wundern, wenn der Tomatensaft aus ist und man am Ende woanders landet.
Pünktlichkeit einfordern
Meine Schüler:innen wissen: Wer zu spät kommt, kommt nicht einfach später in den Raum dazu. Ich bin da nicht der coole Kumpellehrer, der sagt: „Ach, wie geht es dir heute? Willst du uns vielleicht kurz von deinem Morgen erzählen?“ Nein. Wenn du zu spät kommst, dann spürst du, dass du zu spät bist.
Es gibt keine Begrüßungszeremonie für zu spät kommende Kids. Sie kommen rein, langsam, leise, und schauen mich an. Und dann warte ich. Ich entscheide, ob du sie sich setzen dürfen. Und ob sie danach noch Extra-Aufgaben übernehmen. Nicht als Strafe. Pädagogische Konsequenz. Weil Pünktlichkeit nicht verhandelbar ist.
Ich glaube: Schule muss immer freundlich sein – aber nicht beliebig alles hinnehmen. Wenn ich erwarte, dass mein Unterricht ernst genommen wird, dann muss ich selbst dafür sorgen, dass das passiert. Und das fängt bei sowas an: Zuspätkommen ist kein Kavaliersdelikt. Es ist unhöflich.
Und: Vorleben zählt
Klar: Der Timer allein ist kein Wundermittel. Wenn man selbst ständig überzieht, ist das Signal klar: Uhrzeit ist Deko. Und die eigene Autorität gleich mit.
Also: pünktlich anfangen. Pünktlich aufhören. Pünktlich sein. Meine Kids gehen immer pünktlich in die Pause. Immer. Keine Minute klaue ich ihnen.
Und ja – das gilt auch für uns Lehrkräfte. Kolleg:innen, die es partout nicht schaffen, ihren Unterricht zu beenden, wenn meiner beginnt, machen mich fertig. Diese zerfließende Übergabe-Energie. Diese ultraentspannte „Ich bin hier noch kurz am Atmen“-Haltung, wenn ich schon in der Tür stehe. Ich pack es nicht. Es ist schlicht: unhöflich. Nicht langsam. Nicht besonnen. Unhöflich.
Jede Klasse tickt
Bei uns an der Schule: Glück gehabt. Startchancenprogramm. Extra-Budget. Ich darf koordinieren. Und wir haben jetzt jeden Raum mit einem großen TimeTimer ausgestattet. Large. 60–70 Euro das Stück. Dazu: mobile Mini-Timer für Gruppenarbeiten. Heißt: Kein Suchen, kein Leihen, kein Improtheater. Jeder Raum tickt.
Fazit
Natürlich wird niemand durch einen Timer zum Mathegenie. Aber: Weniger Störung = mehr Lernzeit. Und das ist keine Pillepalle-Pädagogik. Man kann das vermutlich nicht mit irgendeinem p-Wert oder Konfidenzintervall belegen – aber man spürt es. Deutlich.
Wer die Uhr führt, führt die Klasse. Nicht perfekt. Aber besser als vorher. Und das reicht.
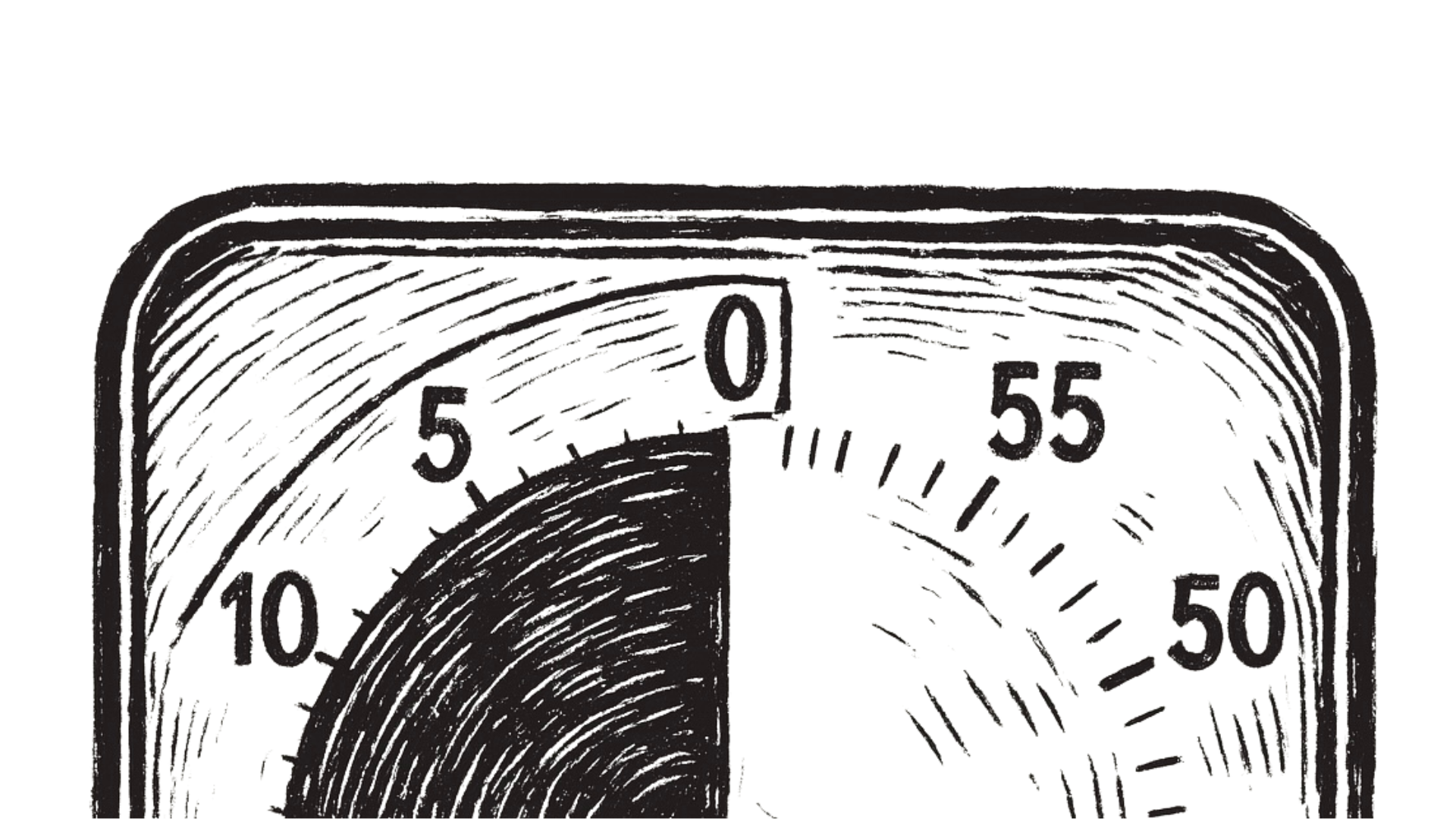
Sag mir die Meinung. Bleibt privat. Wird nicht veröffentlicht.