Vor drei Jahren hab ich „Building Thinking Classrooms“ (kurz: BTC, deutsch: Denkende Klassenzimmer) gelesen. Zunächst auf Englisch. Und ziemlich schnell wieder ins Regal gelegt. Wieder ein Didaktiker, der keine Ahnung von Schulen in krasser Lage hat und irgendwie seine Existenz mit einem Buch sichern muss. Man wird mit der Zeit leider zynisch. Man bekommt von allen Seiten so viele Ratschläge. Schläge, die bei uns an der Schule nicht funktionieren. Nicht mit meinen Kids, die regelmäßig ihre Sachen vergessen, manchmal nur mit Bauchtasche zur Schule kommen und bei Gruppenarbeit auch mal völlig ausrasten.
Dann noch immer Arbeiten in Zufallsgruppen? Stehend an Tafeln? Aufgaben nur mündlich mitteilen? Was ein Bullshit, hab ich gedacht. „Schön fürs Kartoffel-Gymnasium – aber bei mir? Never.“ Das Konzept widerspricht dazu an so vielen Stellen jeder Form von Didaktik, die ich gelernt habe und an die ich mich tagtäglich klammere.
Dann waren da mal wieder die Noten. Schlechte Noten. Trotz allem. Trotz Erklärvideos, differenzierten Materialien, klugen Methoden, eigener Lerncloud. Der Durchschnitt blieb so krass mies. Ich war frustriert. Ich hatte das Gefühl, mir gehen die Strohhalme aus, an die ich mich klammere. Vielleicht war mein Unterricht einfach für die Tonne?
Dann musste ich im Mai 2025 auf diese Fortbildung, auf die ich eigentlich keinen Bock hatte, aber hin sollte. Wille von oben und so. Alles war mir in dem Moment zu viel. Und wieder tauchte auf der Fortbildung nebenbei dieser Name auf: Peter Liljedahl. Diesmal blieb ich nicht zynisch. Ich hörte zu. Anders. Und las im Anschluss das Buch noch mal. Diesmal auf Deutsch. Am darauffolgenden Wochenende zog ich mir zahlreiche YouTube-Videos und Interviews zum Konzept rein. Jedenfalls traf es mich diesmal. Voll.
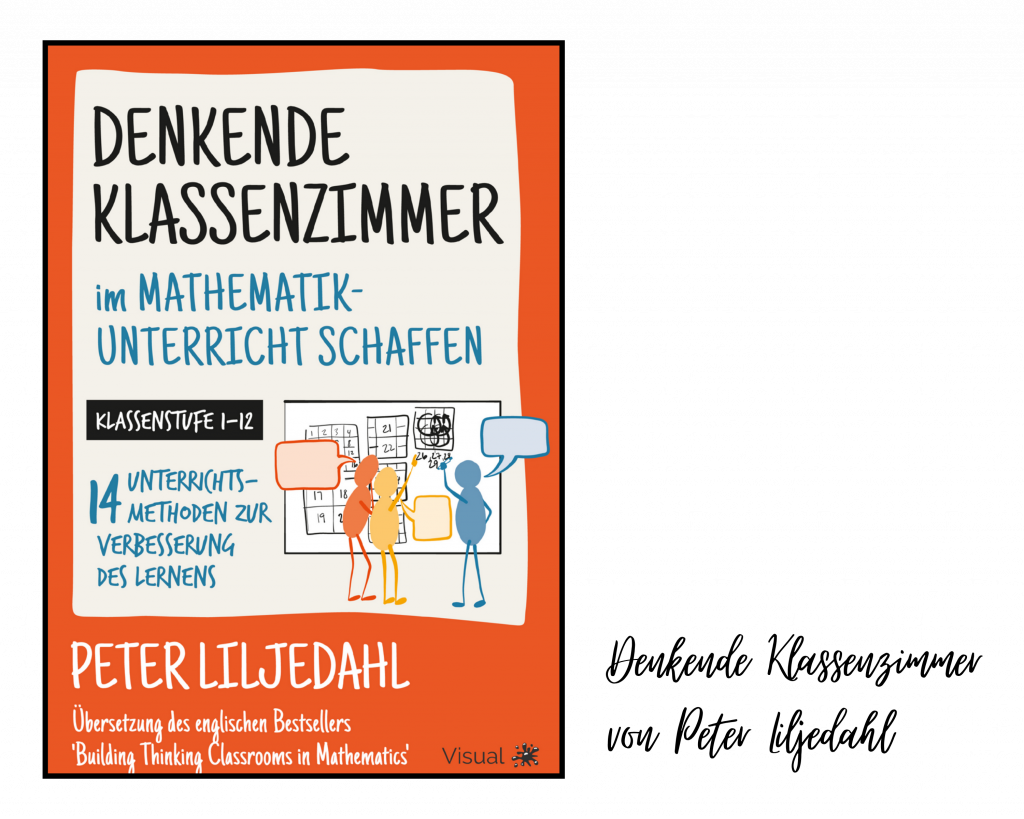
Und dann hab ich’s gemacht. Komplett. Kein Testlauf. Kein vorsichtiges Experiment mit der 7b. Nein: drei Whiteboards für meine Klasse gekauft, selber montiert, alte Tafeln reaktiviert, Zeug abgehangen, Klassenraum auseinandergenommen, bewährte Sitzordnung beerdigt. All in.
Das Ding ist: Dieses Konzept ist nicht nett. Es ist nicht ein bisschen anders. Es zerlegt klassischen Unterricht.
Das Konzept
Das eigentliche Problem?
Kinder denken nicht in der Schule.
Das ist Liljedahls Analyse. Und sie hat bei mir voll eingeschlagen. Weil sie stimmt. Ich habe das erst jetzt so richtig begriffen.
Schüler:innen denken nicht. Nicht, weil sie nicht wollen. Sondern weil sie es nie gelernt haben. Nie gelernt, sich in ein Problem zu verbeißen. Nie gelernt, über eine Frage zu stolpern und dann trotzdem weiterzumachen. Ich habe damals gedacht, sie sind einfach zu faul, zu desinteressiert, zu träge und mein Unterricht zu kacke. Aber nein: Sie können einfach nicht denken, weil sie es nie in ihrem Leben richtig üben konnten. Die Ursachen sind sicherlich multipel. Aber das ist das Kernproblem.
Und genau hier setzt Liljedahl an. Genau hier knallt das Konzept rein wie ein Tritt in die Tür. Sie zwingt Schüler:innen zum Denken.
Wie ein Thinking Classroom tickt
Der Unterricht nach Peter Liljedahl folgt Prinzipien – vielen. Aber im Kern geht es um eins: Denken. Nicht reproduzieren. Nicht nachmachen. Denken.
Aufgaben, die wehtun
Am Anfang einer Stunde steht keine Rechenregel. Kein materialintensiver Stundeneinstieg, wie man es im Ref lernt. Keine „So-geht-das-Einführungsphase“. Sondern eine Aufgabe. Eine verdammt gute Aufgabe. Die muss so schwer sein, dass die Kids erstmal so richtig ins Schwimmen kommen. Aber so klug gebaut, dass sie weiterschwimmen und beim Schwimmen auf genau die Idee stoßen, die man braucht. Entdeckendes Lernen, ja. Aber ohne pädagogisches Wattebausch-Gelaber.
Was sich sonst noch ändert – alles:
- Raumumbau: Der Thinking Classroom beginnt mit einem entfrontetem Raum. Die Wände sollen frei sein, die Sitzordnung etwas dichter – ggf. Gruppentische in der Mitte, freie Flächen an den Wänden. Das Lehrerpult? Nicht frontal, sondern woanders. Bei mir: Tische zu Inseln zusammengeschoben, alles zur Fensterseite hin verlagert, drei Wände freigeräumt, Pult mittendrin. Ich bin als Lehrer Teil des Rudels.
- Arbeiten an Tafeln und im Stehen: Gearbeitet wird an vertikalen, non-permanenten Flächen – Tafeln und Whiteboards. Es wird fast die ganze Stunde gestanden, nicht gesessen. Das beschleunigt, macht Diskussionen sichtbar, senkt die Hürde für Fehler. Wegwischen, weitermachen. Do it.
- Zufallsgruppen: Gruppen werden zufällig gebildet. Jede Stunde neu. Keine Wahlfreiheit, keine pädagogisch kluge Zusammenstellung. Das durchmischt Routinen und öffnet neue Gesprächswege. Immer Dreiergruppen. Zur Not auch mal zwei, aber nie vier. Und immer im Stehen. Die alten Sitzplätze bleiben – man braucht sie später wieder für die Sicherung. Ich nutze die App Zufallsgenerator – super simpel: Lerngruppe anlegen, Anwesenheit vermerken, App auf dem Display / Beamer spiegeln, „Generieren“ klicken. Und los geht’s. Die Kids müssen das einfach akzeptieren. Ich auch! Es ist nur eine Stunde. Und ja – da müssen jetzt alle durch. Kollaboratives Arbeiten, wie im echten Leben. Ende.
- Mündliche Aufgabenstellung: Die Aufgaben kommen nicht als Kopie frisch aus dem Drucker, sondern direkt aus dem Mund der Lehrkraft. Mündlich, schrittweise. Bei Bedarf ein paar Zahlen an der Tafel zusätzlich vermerken – mehr nicht. Wer denkt, muss zuhören. Wer zuhört, kommt rein. Kein Blatt, hinter dem man sich verstecken kann. Danach fangen die Gruppen direkt an, zu arbeiten. Wer schneller ist? Bähm! Zusatzaufgabe, Liljedahl nennt es Erweiterung.
- Fragen von Schüler:innen? Wer fragt, bekommt ’ne Gegenfrage. Kein Lösungsweg, kein Richtig oder Falsch. Nur: „Denk nochmal.“ Als Lehrer ist das verdammt schwer auszuhalten. Aber da muss man durch. Übung hilft.
- Reflexion: Etwa im letzten Drittel der Stunde werden die Ergebnisse präsentiert – ähnlich wie bei einem Gallery Walk. Die Gruppen zeigen sich ihre Lösungswege, diskutieren, kommentieren. Die Lehrkraft moderiert das, bringt die Fäden klug zusammen, leitet gezielt auf die Sicherung zu.
- Sicherung: Danach folgt eine Phase der individuellen oder angeleiteten Sicherung – im Heft. Mal durch mich als Lehrer gesteuert, mal eigenständig. Hängt davon ab, wie die Stunde lief. Die Sicherung ist responsiv – sie wird an den Verlauf und das Verständnis und die Ergebnisse der Schüler:innen zuvor angepasst, nicht umgekehrt.

Was ist dann passiert?
Ich habe es umgesetzt. Ein Schüler, der nie redet, erklärt plötzlich der Klasse seine Lösung. Laut. Und mit voller Stolz. Ein anderer – einer meiner härteren Fälle, der eigentlich längst in den Grundkurs sollte – sagt einem Mitschüler am Ende der Stunde wütend: „Nicht wegwischen, Bruder. Ich will da nach der Pause noch mal draufgucken.“ Andere Schüler:innen, die nie miteinander reden, streiten um 13:40 Uhr bei 28 °C und kacken sich heftig an, warum ihre Lösung die jeweils richtige sein soll.
Und das in Mathe. Bei Wahrscheinlichkeitsrechnung, in einem anderen Kurs bei Gleichungen. Mit 15-Jährigen. Kein Märchen. Das ist passiert. Ich komm darauf nicht klar.
Ich hab keine Studien. Keine Excel-Tabelle mit Vorher-Nachher-Schnitt. Aber Liljedahl schreibt, dass dieses Konzept – richtig eingesetzt – den Schnitt um 1,5 Notenstufen hebt. Effektstärke +1,0 bis +1,5. Klingt irre. Aber nur, wenn man’s konsequent macht. Nicht einmal die Woche. Sondern jeden Tag. Ganz. Radikal.
Wenn das klappt? Wär ein Traum.
Ach ja: Ich mache das nicht nur in Mathe. Ich habe es auch in Geschichte und Wirtschaft probiert. Keine Erklärung, kein Tafelbild, kein Schema F. Sondern eine Frage. Eine Aufgabe. Und sie denken sich rein. Auch das war krass.
Nach den Ferien geht’s weiter. Ich werde weiter feinschleifen, mich noch tiefer in das Konzept reinarbeiten, ausprobieren, anpassen. Und hier darüber schreiben – genauer, konkreter. Über meinen Unterricht. Über einzelne Phasen. Über das, was funktioniert. Und das, was nicht.
Das hier war der Einstieg.

Sag mir die Meinung. Bleibt privat. Wird nicht veröffentlicht.