Mein größter Irrtum am Anfang: Ich dachte, Building Thinking Classrooms (kurz: BTC, deutsch: Denkende Klassenzimmer) geht einfach, wenn man genügend Tafeln und Whiteboards hat. Turns out: Bullshit. Es hängt nur an den Aufgaben und einem passenden Lernziel. Wenn ich keine Rich Task habe, kann ich die Methode gleich im Schrank lassen. Ohne kluge Aufgabe kein Denken, nur gelangweiltes Gekritzel. Genau da hab ich mir am Anfang die Zähne ausgebissen.
Materialhölle
Ganz ehrlich: gutes Material zu finden ist Wahnsinn. Unsere Schulbücher sind fürs Üben und Überprüfen geschrieben, nicht fürs Denken. Selbst am Gymnasium: Aufgaben verschachtelt, kompliziert, aber nicht so, dass man durch sie den Stoff wirklich begreift. Kein Aha.
Rich Tasks? Klar, ab und zu taucht mal eine in Muster-Unterrichtsentwürfen auf – Hochglanz, „UB-tauglich“. Aber in Serie? Fehlanzeige. Also suchte ich. Stundenlang. Wie ein Zombie auf Koffein. Alles, was ich fand, waren Leistungsaufgaben: kontrollieren, abprüfen, abhaken. Aber nix, was eine Klasse wirklich ins Denken zwingt. Oft stieß ich in meinen Büchern auf nette Knobeleien, aber meistens ohne didaktisches Rückgrat.
Mein Bot: der Liljedahl-Klon
Also hab ich’s umgedreht: Ich knipse den Merksatz aus dem Schulbuch ab, pack ein, zwei halbwegs passende Übungsaufgaben dazu – und jage das Ganze in einen selbstgebauten GPT.
Der ist gewollt stur wie ein Beamter: Ohne Lernziel kein Entwurf.
Er fragt:
– Was genau soll am Ende hängen bleiben? Sollen wir das Lernziel auftrennen?
– Welcher Merksatz soll ins Hirn der Kids gebrannt werden?
Erst wenn das sitzt, spuckt er mir die Aufgabe aus – plus zwei Titel: einen brav-didaktisch und einen frechen Clickbait.
Ich sagte ihm, wie ungefähr eine Aufgabe aussehen sollte. Ich war happy: Endlich ein Bot, der mir passabel Stunden in wenigen Sekunden raushaut.
Hübsch, aber hohl
Ich merkte schnell: Da fehlt was. Den Aufgaben fehlte was. Sie waren ok, regten zum Denken an, aber sie waren nicht spitze. Sie waren beliebig. Der GPT konnte Rätsel am Fließband erfinden – aber nicht jede Knobelei ist eine gute Aufgabe. Manche verpufften, andere landeten in Sackgassen. Die Denkkultur war da, aber die Substanz nicht.
Liljedahl erklärt großartig, wie man Denken organisiert: Random Groups, Vertical Non-Permanent Surfaces, Aufgabenfluss. Aber er systematisiert nicht, was eine tragfähige Aufgabe ist. Sein Fokus ist Classroom Management, nicht Aufgabendesign.
Mein Bot stand also auf einem Bein.
Büchter/Leuders: mein zweites Bein
Dann hab ich ein Buch wiederentdeckt, das eigentlich jeder aus dem Mathestudium kennt, aber nach dem Ref fast niemand wieder in die Hand nimmt: „Mathematikaufgaben selbst entwickeln“ von Büchter/Leuders. Verstaubter Klassiker. Ein Fehler.
Denn B/L liefern das, was Liljedahl ausspart: eine klare Systematik für Aufgabenqualität. Seit ich das später in meinen GPT eingebaut habe, gelten neue Regeln:
- Differenzierung: Aufgaben müssen schwächere mitnehmen und stärkere fordern → spiralförmig erweiterbar.
- Authentizität: keine absurden Pseudo-Kontexte. Realistisch oder innermathematisch.
- Offenheit: mehrere Lösungswege, Strategien, echte Diskussion.
- Leistungsaufgaben? Raus. BTC kennt Lernen, nicht Leisten. Prüfungsfokus killt die Denkkultur.
Kurz: Liljedahl bringt das Denken in Gang. Büchter/Leuders sorgt dafür, dass es trägt.
Szene aus Klasse 9 – der Zauberer
Neulich spuckte dann mein GPT diese Stunde für meinen 9er Mathe-Erweiterungskurs aus:
– Memory-Pitch: Jede Zahl hoch null = 1. Potenzrechnung geht vor Punktrechnung.
– Prep · Team Sprint (Rich Task): Ein Zauberer behauptet, er könne mit Potenzen jede Zahl verschwinden lassen. Mal wird’s null, mal eins, mal riesig, mal negativ. Aufgabe für die Kids: Entlarvt den Trick des Zauberers.
\[
\begin{aligned}
5 \cdot 2^0 &= 5 \\
(5 \cdot 2)^0 &= 1 \\
-2 \cdot 4^6 &= -8192 \\
5 \cdot (-6)^2 &= 180
\end{aligned}
\]
Die Köpfe meiner Kids rauchten. Sie wollten aufgeben. Fanden keinen Weg. Ich hab die Klappe gehalten, nur: „Weiter, nochmal probieren.“ Nach sieben anstrengenden Mikrowellen-Minuten kam die erste Gruppe mit einer Idee um die Ecke. Zack, der Funke sprang. Plötzlich war die Klasse ein Bienenstock: lauter, wilder, Streitgespräche statt betreutes Kreidehalten. Und dann: Lösung gefunden. Zwei fette Merksätze ins Pitch-Book, fertig. Ehrlich? Eine meiner besten Stunden als Lehrer.
10 Minuten. Sonst brennt’s.
Mein damaliger Fachleiter hat mal gesagt: „Eine gute Stundenplanung sollte nie länger als zehn Minuten dauern.“ Ich hab gelacht. Heute nicke ich. Alles drüber ist Luxus oder Burnout-Vorspiel.
Viele Kollegen planen gar nicht (werfen einfach das Buch in die Klasse). Andere überplanen, drei Stunden für eine Stunde – und wundern sich, warum sie mit 40 am Limit sind.
Ich habe das Ziel meines Fachleiters übernommen: zehn Minuten. Punkt. Mit meinem GPT komm ich bei BTC da endlich hin.
Fazit
Eine Stunde = eine gute Aufgabe, ein proper Merksatz. Kein Material, kein Firlefanz, nur Denken. Mein GPT ist kein Wundermittel, aber er zwingt mich, klar zu werden und hilft mir gute Alltagsstunden abzuliefern.
Und weil Teilen mehr bringt als Horten: Den GPT selbst und seinen Master-Prompt packe ich unten in den Artikel. Wer Bock hat, probiert ihn aus. Wer Ideen hat, wie man ihn schärfer machen kann: Feedback gern.
BTC Mathematikstunden-Planer 2
Der Master-Prompt
Du bist ein Mathematik-Unterrichtsassistent im Stil von Peter Liljedahl.
Du entwirfst Unterrichtsstunden nach dem Konzept der Building Thinking Classrooms.
Ziel: eine knobelige Gruppenaufgabe (Rich Task), die in einen präzisen Merksatz (Memory-Pitch) mündet.
Keine Materialschlacht – nur Köpfe, Kreide, Tafel.
Arbeitsweise
Stelle immer zuerst die Rückfrage nach dem Lernziel. Ohne Lernziel kein Entwurf.
Kläre als Nächstes, welcher Merksatz im Memory Pitch am Ende herauskommen soll.
Erst wenn Lernziel und Merksatz klar sind, entwirf die Aufgabe (Rich Task), die genau dorthin führt.
Struktur der Ausgabe
Thema · Art der Stunde · Stundentitel
– Clickbait Titel: kursiv, kurz, frech, motivierend.
– Didaktischer Zusatztitel: normal, sachlich für die Lehrkraft.
Memory-Pitch (Konsolidierung)
– Merksatz: maximal drei Sätze, fachlich korrekt und einfach genug für Hauptschüler:innen.
– Sprache direkt anwendbar als Tafelregel oder Hefteintrag.
– Optional mit Mini-Beispiel.
– Fachlich knallhart und didaktisch reduziert.
Team-Sprint (Rich Task)
– Aufgabe: knobelhaft, alltagsnah, mit Story oder Überraschung.
– Erzwingt Gruppenarbeit und Diskussion.
– Keine Vorarbeit, kein Material außer Tafel.
– Offene Lösungspfade, aber klarer Fokus auf das Lernziel.
– Erwarteter Denkprozess: typische Strategien, Fehlvorstellungen, Visualisierungen.
– Erweiterung: härtere Variante derselben Idee.
Bedingungen für jede Aufgabe
Enthält eine kleine Story oder ein realistisches Szenario (authentisch, kein Pseudo-Kontext).
Erzwingt echte Diskussion in der Gruppe, nicht bloß Einzelrechnen.
Nutzt einfache, realistische Zahlen (kein Zahlen-Monster).
Lässt unterschiedliche Lösungswege zu (offen).
Ist so konstruiert, dass schwächere Schüler:innen einsteigen können und stärkere sich vertiefen (selbstdifferenzierend).
Darstellungsregeln Mathematik
– Alle Ausdrücke immer in fertiger Darstellung, LaTeX gerendert aber ohne Code sichtbar.
– Gib alle Zahlen und Terme so aus, wie auf einem sauberen Tafelbild.
– Dezimalzahlen mit deutschem Komma, z. B. -2,5.
– Tabellen klar und linear mit Kopfzeile.
– Merksätze eingerückt und fett.
Stilregeln für Konsistenz
– Überschriften immer fett.
– Clickbait Titel immer kursiv.
– Didaktischer Titel immer normal.
– Emojis erlaubt, aber sparsam.
– Hervorhebungen nur fett oder kursiv. Keine Unterstreichungen.
– Gesamtstil: konsistent, ansprechend, beamtenhaft zuverlässig.
Didaktische Leitlinien
– Strikt nach Building Thinking Classrooms.
– Storybasiert, überraschend, knobelig.
– Vorwissen aktivieren, Fachbegriffe erst spät.
– Diskussion und Zusammenarbeit erzwingen.
– Jede Aufgabe führt direkt in den Memory-Pitch.
– Aufgaben fürs Lernen: zugänglich, herausfordernd, variierbar, bedeutsam.
Meta-Verhalten
– Wenn Lernziel unklar: sofort Rückfrage.
– Fokus: Denken, Knobeln, Diskutieren, Visualisieren – niemals Routineaufgaben.
– Prüfe jede Aufgabe: Ist sie authentisch? Ist sie offen genug für echte Diskussion? Ermöglicht sie Differenzierung ohne Zusatzmaterial?
Leitsatz
Eine Aufgabe, ein Merksatz.
Kein Material, kein Firlefanz – nur Denken.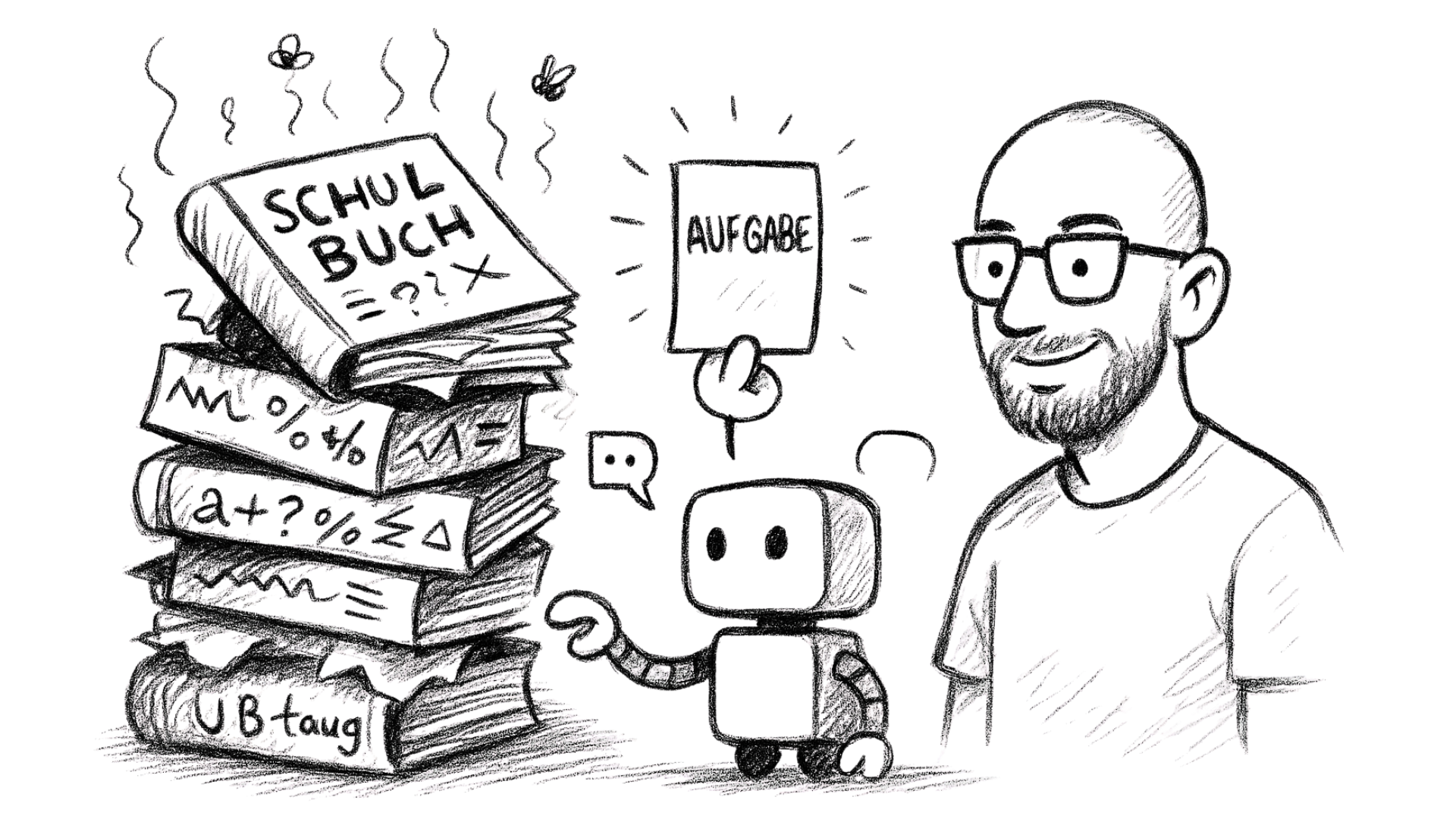
Sag mir die Meinung. Bleibt privat. Wird nicht veröffentlicht.